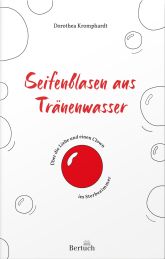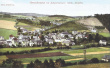Torgaus Kurfürsten: der Weise, der Beständige, der Großmütige
Vor 500 Jahren verstarb nahe bei Torgau, in Annaburg (Lochau), Kurfürst Friedrich III., genannt der Weise. Wir haben in Torgau ein „Erinnerungsjahr“ für diesen besonders befähigten Fürsten ausgerufen, der hier im Schloss 1463 geboren wurde und in Torgau sein Haupthoflager mit der Kanzlei unterhielt.
Wie kam es eigentlich zu diesen Beifügungen, wie eben „der Weise“? Auch bei nachfolgenden Kurfürsten finden sich mit „der Beständige“ oder „der Großmütige“ ähnliche Bezeichnungen.
Dazu einige Erläuterungen: Die genannten Attribute erhielten die Fürsten durch Personen, die die Geschichte der jeweiligen Herrschaft aufschrieben, mitunter bereits schon durch die Zeitgenossen wie Martin Luther oder Georg Spalatin.
Kurfürst Friedrich III., genannt „der Weise“, hatte nie an einer Universität studiert. Er war durch Hoflehrer auf das Kurfürsten-Amt solide vorbereitet worden. Aber eine offenbar natürliche Anlage war bei ihm charakteristisch. Bei Konflikten sich gegenüberstehender Parteien neigte er dazu, einen Ausgleich der Interessen herbeizuführen. Der „weise“ Friedrich wurde zu einem allseits angesehenen und gesuchten Vermittler.
Wie funktionierte eine solche Methode? Betrachten wir einmal solche gegensätzlichen Interessen, etwa die des Kaisers und Herrschers des damaligen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und jenen der Untertanen, solchen der Länder und mitunter Städte regierenden Fürsten und Geistlichen. Friedrich der Weise wendete, um diesen aufeinanderprallenden Kräften die Wucht zu nehmen, ein Vorgehen an, das man anschaulich mit „sympathisierender Zurückhaltung“ bezeichnen kann. Jene der zwei Parteien, die mit ihren Forderungen extrem zu werden schien, bekam, trotz einer ihr weiter gewährenden „Sympathie“, doch Zurückhaltung; ja, des Vermittlers Passivität auferlegt. Deren Überschießen konnte im Leeren landen.
Aber, welche der Konfliktparteien hatte schon so etwas mit sich machen lassen? Wie konnte der sächsische Kurfürst Friedrich der Weise so souverän sein, dass er beim Vermitteln sogar den Kaiser diplomatisch ausgleichend „bewegen“ konnte? Nun, der sächsische Kurfürst war als Vermittler allseits anerkannt, weil er finanzökonomisch eine solche Stärke und Sicherheit entwickelte, dass er stets schuldenfrei, solide Kursachsen regieren konnte. Der Silberbergbau im Erzgebirge half dabei. Von Haus aus war es mit Klugheit und Bedachtsamkeit, Beherrschtheit sowie mit einem nicht nur machtpolitisch-bestimmenden, vielmehr auch mit christlich-moralischem Denken und Handeln ausgerüstet. Bei seinen Entscheidungen stützte sich Friedrich der Weise auf das alte Römische Recht, das die Würde des Individuums wohl bedachte. Ein Recht, das in der damaligen Verfassung („Goldene Bulle“) Eingang gefunden hatte. Der Kurfürst war neben dem Vermitteln zugleich „Kontrollorgan“ beim Einhalten des Rechts.
Ein Wort noch zu Martin Luther, dem der (weise) Kurfürst auf der Wartburg, 1521, Schutz gegeben hatte. Obgleich er als Landesvater im damaligen „alten“ Glauben feststehender Christ war, erkannte er, dass die durch Luther begonnene Kirchenerneuerung den Ärmeren im Land helfen würde. Er zeigte der „neuen“ Kirche seine „Sympathie“. Den Luther-Gegner gegenüber ließ er, um wieder in eine „Balance“ zu kommen, seine „Zurückhaltung“ spüren.
Und das Resultat? Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation blieb ein über Jahrzehnte andauernder politischer Frieden erhalten und zwar in der Situation einer bestehenden Bikonfessionalität, der zwischen katholischer und evangelischer Glaubensrichtung. Das war ein Verdienst von Friedrich dem Weisen.
Auf Friedrich folgte 1525 sein Bruder Johann I., genannt „der Beständige“. Auch der neue Kurfürst sympathisierte mit der neuen, evangelischen Kirche. Da das Reich einen Türkeneinfall zu verzeichnen hatte, gab sich der Kaiser Karl V. auf dem Reichstag in Speyer, 1526, hinsichtlich der Festlegung, wieder nur die katholische Religion im Reich zu haben, milde. So wurde in Speyer verabschiedet, „Was jeder vor Gott und Kaiser verantworten könne“, soll als christliche Religion existieren.
Wenige Jahre nahmen Kaiser und Papst diesen zuvor, recht gut ausbalancierten Reichstagsabschied zurück. Kurfürst Johann I. protestierte und forderte den „Bestand“ des in Speyer einst Beschlossenen. So bekam der Kurfürst Johann I. die Beifügung, „der Beständige“ und die evangelisch-lutherischen Christen nannten sich fortan „Protestanten“ (protestantische Kirche). Ein Krieg zwischen dem Kaiser und dem Kurfürsten war allerdings unvermeidlich geworden.
Auf Johann dem Beständigen folgte 1532 Johann Friedrich I., „der Großmütige“. Er ließ in Torgau, im damaligen „goldenen Zeitalter“ der Stadt, das bekannte, noch heute recht prächtig erscheinende Schloss mit Kapelle bauen. Er war großzügig gegenüber der Lutherischen Kirche und errichtete mittels Konrad Krebs, Lucas Cranach, Johann Walter u. a. eine Hofkultur auf höchstem Niveau. Er war in allem „großmütig“, darauf hin „der Großmütige“ genannt.
Beides, Glaube und Macht, hierin eingebunden das Militärische, konnte er allerdings nicht gleichsam hinreichend und anhaltend ausfüllen. Er verlor die Schlacht bei Mühlberg 1547. Das „goldene Zeitalter“ Torgaus verging.
Wir als Förderverein Europa Begegnungen e.V.* und sein „Bürgerschaftliches Kollegium“ werden im „Friedrich der Weise-Erinnerungsjahr“ die Glanzzeiten unserer Stadt Jedwedem weiter nahebringen.
Bildnachweis
Schloss Hartenfels, Torgau. Urheber: Kora27 - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 international“
Die Gemälde der Kurfürsten von Sachsen schuf Lucas Cranach. Aus Wikipedia – gemeinfrei.