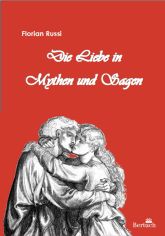Der Städtische Zentralfriedhof Chemnitz
Im Zuge der industriellen Revolution von 1830 bis Ende des 19. Jahrhunderts verzehnfachte sich die Einwohnerzahl von Chemnitz auf rund 200 000 Einwohner. Die hohe Sterblichkeit, erhöht durch eine Choleraepidemie 1866, bewirkten die Überlastung der Aufnahmefähigkeit der bestehenden Friedhöfe. Unumgänglich war die Einrichtung eines Neuen Friedhofs, der außerhalb des Stadtzentrums im Stadtteil Bernsdorf angelegt wurde. Die Arbeiten dazu begannen im Frühjahr 1871. Heute firmiert er als Städtischer Zentralfriedhof der Stadt Chemnitz.
Das Krematorium
Zur Geschichte der Feuerbestattung in Sachsen schrieb Alfred E. Otto Paul, ein profunder Kenner der Sepulkralkultur aus Leipzig:
„Über ein Jahrtausend galt das im Jahre 785 vom Kaiser Karl dem Großen in seinem Paderborner „Kapitulare“ verfügte Verbot der Leichenverbrennung, da es als heidnisches Brauchtum der einsetzenden Christianisierung widersprach. Im 18. Jahrhundert besann man sich aber im Zuge der Aufklärung zunehmend des aus der Antike stammenden Brauchs der Brandbestattung von Verstorbenen...Erst viel später und anfänglich regional begrenzt, erlangte die Idee der Feuerbestattung durch die Gründung zahlreicher Feuerbestattungsvereine und deren unermüdliche Arbeit die rechtliche Zulässigkeit. Dadurch wurde die Errichtung und der Betrieb von Krematorien – 1876 in Mailand, 1878 in Gotha – praktische Wirklichkeit. So setzte sich der Siegeszug der Feuerbestattung weltweit unaufhaltsam fort.“ (Vergleiche dazu https://www.sachsen-lese.de/vorgestellt/kultur/zur-geschichte-der-feuerbestattung-in-sachsen/)
In Sachsen setzte sich als erster der Chemnitzer Verein für Feuerbestattung, gegründet am 27. September 1885, nach langem, zähem Widerstand vor allem des landesherrlichen Kirchenregiments durch. In einem höchstrichterlichen Urteil wurde festgestellt, dass sich aus den geltenden Gesetzen des Königreiches Sachsen kein Verbot der Feuerbestattung ableiten ließ. Am 15. Dezember 1906 fand der erste Spatenstich zum Bau des Krematoriums statt. Die Einweihung des ersten Krematoriums in Sachsen geschah am 15. Dezember 1906, und am nächsten Tag wurde die erste Einäscherung im Krematorium durchgeführt; es war das erste Krematorium in Sachsen.
Gedenken an die Opfer der Bombenangriffe
Chemnitz wurde von den anglo-amerikanischen Bomben im 2. Weltkrieg schwer getroffen. Die folgenschwersten Angriffe der Alliierten fanden vom 5. zum 6. März 1945 statt. Dabei kamen über 2 100 Menschen ums Leben; die Innenstadt wurde zu 80 % zerstört. Insgesamt gab es vom 6. Februar 1945 an zehn Luftangriffe auf Chemnitz. Diese traumatischen Ereignisse für die Stadt und ihre Bewohner sind fest im Gedächtnis verankert, deshalb wird mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen daran erinnert. Von allen Friedhöfen sind auf dem Städtischen Zentralfriedhof Chemnitz die meisten Bombenopfer beerdigt. Insgesamt sind fünf Gräberfelder für sie angelegt. Das größte ist ein Massengrab, in dem unter einer Rasenfläche mit einem Denkmal 1224 Bombenopfer ihre letzte Ruhestätte fanden.
Im Bombenterror wurde auch 167 Fabriken und 84 öffentliche Gebäude schwer beschädigt oder ganz zerstört. Von diesem Schlag hat sich die Industriemetropole Chemnitz nur sehr schwer erholt.
Der Friedhof als Zeugnisträger der Kulturgeschichte
In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts baute Chemnitz seine Stellung als führende Industriemetropole in Deutschland und international aus. Neben der traditionell verankerten Textilindustrie gewann der Maschinenbau und Fahrzeugbau an Bedeutung. International gelang der Durchbruch auf Weltausstellungen und durch mehrfach Preismedaillen für die neu entwickelten Maschinen und Fahrzeuge. Damit sind zwei Namen verbunden; der Maschinen- und Lokomotivbauer Richard Hartmann und der Werkzeugmaschinenbauer Johann Zimmermann. Da der Städtische Zentralfriedhof ein komplexer Zeugnisträger der Geschichte der Stadt ist, finden sich hier die Gräber der beiden Industriepioniere, die vielfältige hohe Auszeichnungen für ihr Schaffen erhalten hatten.
Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie Chemnitz zum ehemaligen Kristallisationspunkt von Technik und Moderne wurde und was es heute ist, besuchen Sie die Sonderausstellung „Tales of Transformation“, die im Sächsischen Industriemuseum, Zwickauer Straße 119, gezeigt wird, geöffnet von 10 bis 17 Uhr.
Richard Hartmann, geboren am 8. November 1809 in Barr im Elsass, gilt als führender Maschinenfabrikant und Eisenbahnpionier in Sachsen. Ausgebildet als Zeugschmied erreichte er auf den Wanderjahren 1832 Chemnitz, hier erwarb er 1837 das Bürgerrecht. Mit verschiedenen Companions baute er zunächst eine Fabrik für Baumwoll- und Spinnereimaschinen auf, die florierte. Der Durchbruch glückte mit den neuen Vorspinn-Maschinen. 1840 gelang die Erweiterung mit der Herstellung von Dampfmaschinen. Unvergessen bleibt Hartmanns Engagement als Hauptlieferant der Dampflokomotiven für die Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen. Die Produktionszahlen beliefen sich jährlich auf sieben (1848) und 100 Stück (1874). Die 1870 erfolgte Umwandlung in eine Akteingesellschaft unter der Firma Sächsische Maschinenfabrik vormals Richard Hartmann. In den Fabriken waren dazumal 2 700 Mitarbeiter beschäftigt. (Die Höchstzahl war 1923 mit 11 000 Mitarbeitern erreicht.) Die Maschinen wurden weltweit exportiert.
Richard Hartmann starb am 16. Dezember 1878 an den Folgen eines Gehirnschlages in seiner Villa am Kaßberg, die in unmittelbarer Nähe zu seinen Fabriken in Chemnitz lag.
Johann Zimmermann wurde am 27. März 1820 in Pápa (Ungarn) geboren; er starb am 2. Juli 1901 in Berlin und ist auf dem Städtischen Friedhof Chemnitz beigesetzt. Ausgebildet als Schlosser kam er 1839 nach Chemnitz. Er reifte zum Erfinder und Unternehmer heran.
Zimmermann gründete die erste Chemnitzer Werkzeugmaschinenfabrik. Die 1848 errichtete Anlage war die erste Fabrik in Deutschland und in Kontinentaleuropa, die Werkzeugmaschinen herstellte.
Chemnitz war also die Wiege des deutschen Werkzeugmaschinenbaus. Bis zum Ende des 2. Weltkrieges blieb Chemnitz ein wichtiger Standort. Zimmermann erhielt viele hohe Auszeichnungen; so wurde er am 25. Januar 1877 in Wien in den österreichischen Ritterstand erhoben und durfte sich Johann Ritter von Zimmermann nennen.
Weitere Denkmale
In der griechischen Mythologie ist Atropos (deutsch „die Unabwendbare“) die älteste der Moiren, auch bekannt als die Parzen, die drei Schicksalsgöttinnen sind. Atropos als Zerstörerin hatte die Aufgabe, den Lebensfaden zu zerschneiden, deshalb wird sie mit der Schere dargestellt. Gesponnen wurde der Lebensfaden von ihrer Schwester Klotho. Der Lebensfaden war von Lachesis bemessen worden. Atropos wählte die Art und Weise des Todes eines Menschen und den Zeitpunkt.
Ernst Adolf Jähnig war Mitinhaber einer Fabrik für Möbelstoffe. Er brachte sein reiches Wissen aus der Deckenbranche in die Firma ein.

Eine beeindruckende Skulptur, die Georg Hecker seiner Frau widmete.
Bildnachweis
(1) Krematorium, (7) Atropos, (8) Grabmal des Chemnitzer Stadtbaurates E. Hechler – Ausschnitt, (9) Grabmal Familie Jähnig. (10) Skulptur als Grabmal der Eheleute Hecker. Urheberin: Ursula Brekle
(2) Zum Gedenken an 4000 Opfer des anglo-amerikanischen Bombenterrors auf Chemnitz am 5. März 1945. Hier fanden 1224 Bombenopfer ihre letzte Ruhe. Urheber: WolfPack76
(3) Grabmal Richard Hartmann. (6) Werkzeugmaschinen-Fabrik Zimmermann. Beide aus Wikimedia, gemeinfrei.
(4) Denkmalgeschützte Villa des Fabrikanten Richard Hartmann (1809-1878) in Chemnitz, Kaßbergstr. 36 Urheber: Uwe Rohwedder
(5) Grabmal für Johann von Zimmermann. Urheber: Lord van Tasm. Lizenz: „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland“