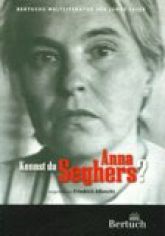Als Goethe wiedereinmal in Karlsbad war, rief ihn sein Herzog nach Teplitz hinüber, weil die Kaiserin Maria Ludovica nach ihm verlangte. In Teplitz aber hielt sich Beethoven zur Kur auf, der sich eine Begegnung mit dem Dichter seit langem sehnsüchtig erhoffte. Denn Goethe war für Beethoven mehr als sonst ein Mensch auf der Erde; wie den Wind der Nacht, wie Mond auf den Wellen, wie einen Gebirgsbach, wie den Morgenstern und die Abendröte liebte er die Zauberhand seiner Sprache um der Musik willen, die sie weckte.
Darum, als der Dichter in seine Stube trat, vergaß Beethoven den Groll, dass ihm der Geheime Rat für seine Musik op. 84 zum Egmont nur förmlich gedankt hatte; auch legte er die Widerborstigkeit ab, mit der er sich sonst gegen Besucher wehrte: kein Knabe hätte sein Glück unverstellter zeigen können, als es das große Kind Beethoven tat, da ihm der stolze Wunsch dieser Begegnung durch die Zuvorkommenheit Goethes erfüllt wurde.
Er stand erst am Anfang seiner missgünstigen Taubheit; er konnte noch hören und der drohenden Stille mit dem Ruf seiner Hände begegnen: den Dichter aus der gemessenen Haltung des Geheimen Rates zu wecken und also sein Glück zu vollenden, spielte Beethoven vor Goethe. Er spielte nicht, was auf einem Notenpapier stand; wie hätte er dem Dichter Dinge wiederholen können, die schon gesagt waren? Er grüßte ihn, dass die Schöpfung noch einmal in ihrer beiden Tagwerk war, wo der Menschengeist sich aus den dunklen Gründen des Leides über die strahlenden Gipfel der Freude erhob, selig im Trotz und Aufbegehren, dem Schicksal gewachsen zu sein.
Wie eine Braut dem Geliebten zu leuchten beginnt, so spielte Beethoven vor Goethe. Der Dichter jedoch, der zeitlebens am Rande der Abgründe gegangen war, die Nachtviolen und Himmelschlüssel seiner Begabung zu pflücken, erschrak vor den Tönen, als ob eine Mure über die Bergwiese käme, ihr Blumenwerk zu verschütten.
„Sie haben köstlich gespielt!“, sagte er, ein Deich gegen den Sturz der Gefühle zu bauen, und schämte sich nicht seiner Abwehr, dass er bis zu Tränen erschüttert war. Beethoven aber hatte nicht am Sitz der Götter gerüttelt, dass einer sein Handwerk lobte; und dass Goethe gerührt war, verzieh er ihm nicht. „Von welchem Bettelpack soll ich mich denn verstehen lassen, wenn ihr mir romantisch kommt wie der Berliner!“, grollte er und hätte den geheimen Rat am liebsten in seine Fäuste genommen, um den Dichter zu wecken.
Am anderen Tag gingen die beiden spazieren und Beethoven strahlte. Weil die Kaiserin mit ihrem Hof in Teplitz weilte, hatten sich viele Fremde angesammelt, von denen manche wussten oder erfuhren, wer die Männer waren. Namentlich die Wiener kannten den im Zylinderhut, wie er mit eingezogenen Ellenbogen durch die Straßen ging, als ob er sich gegen einen Sturm durchkämpfen müsste; sie freuten sich, der wohlbekannten Gestalt hier in Teplitz wieder zu begegnen, und grüßten ihn als ein berühmtes Stück Wien.
Ihre Grüße hätten auch sonst wenig ausgemacht, weil seine Seele meist auf einer anderen Suche als der seiner Sinne war; nun der verehrte Dichter neben ihm ging, gab es nichts in der Welt, das ihm außerdem der Beachtung wert gewesen wäre. Gegen die Neugier, die ihn begaffte, war er sowieso grimmig gestimmt. Dafür musste er bald wahrnehmen, dass Goethe empfänglicher war. Nach seiner Gewohnheit in Weimar erwiderte er jeden Gruß bedachtsam, und soweit es Ehrenbezeugungen waren, bedankte er sich mit Bedeutung.
Wenn wir nur erst in der Landschaft wären! Seufzte er, der seinen Hut zuletzt nicht mehr aus der Hand ließ, sich barhäuptig zu verneigen. Weil aber die Luft in der Nacht blank geregnet war und die Wolken knallig weiß am blauen Himmel schwammen, hatte der Julitag die Fremden in Scharen hinaus gelockt, so dass die Begrüßungen auch draußen nicht aufhörten und Goethe gern die Gelegenheit einer Aussichtsbank wahrnahm, zumal sein Begleiter ihm schnell voraus gestürmt war.
„So sehen die Leute mein Gesicht nicht!“, sagte er schelmisch, mit dem Rücken zur Straße sitzend, und fügte selbstgefällig hinzu, dass die Berühmtheit mehr eine Last denn eine Lust sei. „In Rom war ich inkognito glücklich!“, sagte er. Da kam in Beethoven, der seinen Zylinder unberührt durch die Begrüßungen hindurch getragen und sich an der geheimrätlichen Wichtigkeit des Dichters geärgert hatte, der rheinische Schalk an den Tag: „Regen sich Eure Exzellenz nur nicht auf! Es könnte auch mir gegolten haben!“, sagte er fröhlich. Und das große Kind Beethoven konnte nicht aufhören, über den Spaß zu lachen, als er sich dreist neben dem Geheimen Rat auf die Bank setzte.
Sowohl die Sprache als auch die Rechtschreibung sind der heutigen Sprache von Ursula Brekle angepasst worden.
Bildnachweis
Kopfbild: Toto se nachází poblíž bloku domů Beethovenu. Urheber: Takmocsekretovanej!
Abb. im Text aus Wikipedia, gemeinfrei.