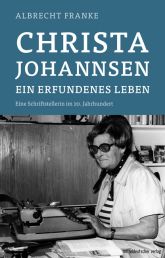Beckenlage, Bleichgesicht
Am Horizont Berge. In der Mitte ein Fluss. Geografisch liegt Chemnitz im Becken. Umrahmt von Erzgebirge und Sächsischem Bergland. Detaillierter: Zschopau-Hochtalboden, Kohlung-Platte, Zeisigwald-Struth-Hügelland, Chemnitztal, Chemnitz-Terrassenriedel, Siegmar-Bornaer Hügelland, Neukirchener Hügelland und Unteres Würschnitztal. Im Gemenge gründete Kaiser Lothar II. 1136 ein Benediktinerkloster St. Marien. Bald erhielten die handelnden Mönche Marktrecht. Eine nahe Furt durchs Gewässer ließ Bauten entstehen, die eine Stadt wurden. Der Ansiedlung gab man den Namen: Chemnitz.
Kamjeń ist der Stein im obersorbischen Sprachgebrauch. Kamjenica nannte man den Bach voller Steine, der durchs Erzgebirgsbecken hier floss. Und diesen Namen nutzte man auch für die Siedlung: Chemnitz. Einheimische verschleifen die Lautung zu Chamtz.
Am 14. Dezember 1357 verlieh Markgraf Friedrich III. von Meißen dem Ort das Privileg der Landesbleiche. Grund genug für Stoff und dessen Herstellung. So wurde auf der großen Wiese nördlich der Stadt auf einem Dreiviertel Hektar eine Bleiche eingerichtet, „die die Voraussetzungen bot, im System von Textilproduktion und -handel eine Zentralstellung einzunehmen“. Chemnitz etablierte sich als Textilstadt. 1451 gab’s dazu noch die Chemnitzer Bleichordnung, damit war der Export ungebleichter Leinen, Garne und Tücher aus dem Meißnischen verboten. „Wir weben, wir weben!“ Sächsische Textilindustrie verband man fortan mit einem Namen: Chemnitz.
Im Ortsteil Harthau errichtete 1798 C. F. Bernhardt seine Spinnmühle und brachte damit der Gegend die industrielle Revolution. Der Hände Arbeit übernahmen Dampf und Maschinen. Erzgebirgische Weber trieb die neue Technik in den Ruin. Arbeiter kamen und bedienten Geräte, Spulen, Hebel und Knöpfe. Fabriksirenen tönten. Die Schornsteine rauchten. Findige experimentierten und verbesserten die Produktionsabläufe. Die Stadt expandierte. Alsbald wohnten hier mehr als Hunderttausend. Chemnitz avancierte zur reichsten Gemeinde Deutschlands. Man nannte sie: Ruß-Chamtz oder Sächsisches Manchester.
Gegen Kriegsende fielen alliierte Bomben. „Insgesamt sind in über 10 Luftangriffen 7.360 t Bomben auf die Stadt abgeworfen worden. Der Denkmalbestand an Kirchen, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern in der historischen Innenstadt und den inneren Vorstädten wurde beinahe vollständig zerstört.“ Der Sozialismus baute neu: die Straße der Nationen, das Hotel Kongress, Café Moskau, Stadthalle, Nischel. Ein wirkliches Stadtzentrum erhielt die Stadt erst nach der Wende. Und doch vermochten Architektur und große Pläne bis heute nicht, die geschichtlichen Wunden vernarben zu lassen.
Namen geben Halt und Rückhalt. Das wusste auch die Staatsführung der DDR, und Ministerpräsident Otto Grotewohl meinte am 10. Mai 1953: „Die Menschen, die hier wohnen, schauen nicht rückwärts, sondern sie schauen vorwärts auf eine neue und bessere Zukunft. Von nun an trägt diese Stadt den stolzen und verpflichtenden Namen Karl-Marx-Stadt.“ Die Volksabstimmung vom 23. April 1990 gab der Industriemetropole den angestammten Namen zurück: Chemnitz.
*****
Textquelle:
Kotte, Henner:Chemnitz: Die 99 besonderen Seiten der Stadt, Halle: Mitteldeutscher Verlag, 2017.
Bildquelle
Vorschaubild: Blick über das Gründerzeitquartier „Kaßberg“ zum Chemnitzer Stadtzentrum 2014, Urheber: Sandro Schmalfuß via Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 de.
Blick auf Chemnitz von Süden her, Lithographie nach einem Gemälde, das 1780 für die Chemnitzer Weberinnung gemalt wurde, Urheber: unbekannt via Wikimedia Commons gemeinfrei.
Historische Luftaufnahme des Harthauer Ortskerns, 1907, Urheber: unbekannt via Wikimedia Commons gemeinfrei.
Arbeitseinsatz der Polizei Chemnitz zur Enttrümmerung der zerstörten Stadt 1945, Urheber: Richard Peter via Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0 de.